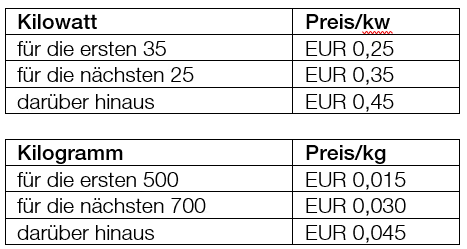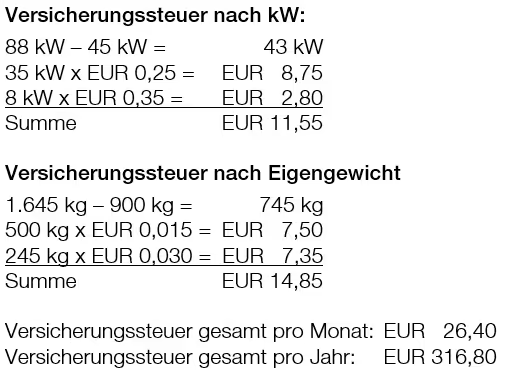Mit dem 5. Mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetz (5. MILG) trat mit 01.01.2026 ein neues Gesetz zur Begren-zung inflationsbedingter Mietzinserhöhungen in Kraft. Wesentliche Neuerungen betreffen die Begrenzung der vertraglichen Wertsicherung von Wohnungsmietverträgen, die Häufigkeit von Mietzinsanpassungen sowie die Verlängerung der Mindestbefristung und eines Rückforderungsanspruches. Die folgenden Informationen stellen einen Überblick über die beschlossenen Bestimmungen dar.
1. MIETZINSDECKELUNG IM TEILANWENDUNGSBEREICH DES MRG
Die im Mietvertrag vereinbarten Anpassungsklauseln bleiben grundsätzlich gültig. Neu ist jedoch, dass die daraus resultierende Erhöhung gesetzlich begrenzt ist und nur noch einmal jährlich zum 01. April angepasst werden darf.
Verlängerung der Mindestbefristung
Bei befristeten Wohnungsmietverträgen wird die gesetzliche Mindestbefristung von drei auf fünf Jahre verlängert. Dies gilt bei unternehmerischer Vermietung, die nach der von der Rechtsprechung entwickelten Faustregel ua bei Vermietung von bis zu fünf Bestandobjekten in der Regel noch nicht vorliegt. Die verlängerte Mindestbefristung gilt für neue abgeschlossene oder verlängerte Mietverträge ab 01.01.2026.
Rückforderungsanspruch
Die Novelle regelt darüber hinaus auch Rückforderungsansprüche aus Zahlungen aufgrund unwirksamer Wertsi-cherungsklauseln neu. Der Rückforderungszeitraum ist auf fünf Jahre beschränkt.
Wie funktioniert die Deckelung?
Maßstab ist die Vorjahresinflation (durchschnittliche Veränderung des VPI des vorangegangenen Kalenderjahres). Für die zulässige Erhöhung gilt:
- Bis 3 %: volle Berücksichtigung
- Über 3 %: der über 3 % hinausgehende Teil darf nur zur Hälfte berücksichtigt werden
Beispiel (Inflation 2025 3,6 %)
- Zulässig ist 3 % + die Hälfte von (3,6 % – 3 %) = 3 % + 0,3 % = 3,3 %.
Der Teil der vertraglichen Indexierung, der über die gesetzlich zulässige Erhöhung hinausgeht, darf nicht verlangt werden und kann grundsätzlich nicht „nachgeholt“ werden.
Die Mietzinsdeckelung ist auch bei bereits bestehenden Wohnungsmietverträgen anzuwenden. Nicht anwendbar ist dieser hingegen auf Mietverträge über Freizeit-Zweitwohnungen, Wohnungsmietverträgen über Ein- oder Zweiobjekthäusern, auf Geschäftsraummietverträge und selbständige Mietverträge von Stellplätzen/Garagen.
Bei der ersten Mietzinsanpassung ab 01.01.2026 ist die Vorjahresinflation nur anteilig zu berücksichtigen, sofern die letzte Anpassung unterjährig erfolgt ist.
Beispiel
- letzte Anpassung zum 01.03.2025
- Indexanstieg 2025 3,6 %
Die Erhöhung im Jahr 2026 gemäß der Mietzinsdeckelung darf höchstens 2,48 % betragen. Berechnung: 3,3 % höchstzulässige Anpassung (bis 3 % volle Berücksichtigung, darüber hinaus nur zur Hälfte) --> aliquot für 9 Monate (nur volle Monate sind zu berücksichtigen!) --> ergibt 2,48 %
2. MIETZINSDECKELUNG IM VOLLANWENDUNGSBEREICH DES MRG
Bei Wohnungsmietverträgen, die dem Vollanwendungsbereich des MRG unterliegen, ist überdies die vertragliche Wertsicherung dadurch begrenzt, dass die Erhöhung im Jahr 2026 höchstens mit 1 % und im Jahr 2027 höchstens mit 2 % begrenzt ist.
3. PARALLELRECHNUNG
Die zulässige Erhöhung ist künftig mittels Parallelrechnung zu ermitteln. Das bedeutet: Es sind immer zwei Rechenwege anzustellen. Maßgeblich ist der niedrigere Betrag.
a) Vertragliche Indexrechnung
Erhöhung nach der konkret vereinbarten Indexklausel (zB VPI-Anstieg seit der letzten Anpassung).
b) Gesetzliche Deckelrechnung
Maximal zulässige Erhöhung nach dem gesetzlichen Deckel (bis 3 % voll, darüber nur die Hälfte).
Beispiel Parallelrechnung
- Ausgangsmiete: EUR 1.000,00
- Vertragliche Indexklausel ergibt: + 3,6 % --> EUR 1.036,00
- Gesetzlicher Deckel bei Vorjahresinflation 2025 iHv 3,6 %: +3,3 % --> EUR 1.033,00
Zulässig ist nur die Erhöhung auf EUR 1.033,00.
4. SPRUNGINDEX-KLAUSELN
Viele freie Mietverträge enthalten Sprungindex-Klauseln: Eine Anpassung erfolgt erst, wenn eine Schwelle (zB 3 % oder 5 %) überschritten wird.
Hier ist künftig ein zweistufiges Vorgehen entscheidend:
Schritt 1: Schwelle prüfen (gemäß Anpassungsklausel im Mietvertrag)
Wird die Schwelle im ersten Jahr nicht erreicht, erfolgt keine Anpassung.
Schritt 2: Wenn die Schwelle später erreicht wird, gilt trotzdem der gesetzliche Deckel
Wird die Schwelle erst im zweiten Jahr überschritten, ist eine Anpassung dem Grunde nach möglich – aber nur im Ausmaß der Parallelrechnung (vertragliche Indexrechnung vs gesetzliche Deckelrechnung für beide Jahre kumuliert).
Beispiel (Überschreiten der Schwelle erst im zweiten Jahr)
- Letzte Anpassung: Jänner 2025
- Sprungindex: Anpassung erst ab 5 % Erhöhung
- Bis Jänner 2026: Indexanstieg 3,6 % --> keine Anpassung
- Bis Jänner 2027: kumuliert 6,1 % (3,6 % in 2025 und 2,5 % in 2026) --> Schwelle erreicht --> Anpassung grundsätzlich möglich
- Zulässig ist aber nur die Erhöhung, die sich aus der Parallelrechnung unter Berücksichtigung der Mietzinsdeckelung ergibt:
- Die Berechnung hat nun Schritt für Schritt zu erfolgen: Zunächst wird der gesetzliche Deckel für 2025 ermittelt (hier in Höhe von 3,3 %; 3,0 % zuzüglich der Hälfte der 3,0 % übersteigt)
- Zum solcherart ermittelten Zwischenergebnis wird nun der gesetzliche Deckel für 2026 hinzugerechnet (hier in Höhe von 2,5 %; volle Berücksichtigung, weil unter 3,0 %).
- Insgesamt ist in diesem Beispiel somit eine 5,8 % Erhöhung unter Berücksichtigung der Deckelung zulässig.
5. ANPASSUNG MIETVERTRAG/TIPP
Um den mitunter sehr aufwendigen Berechnungen (insbesondere die Parallelrechnung sowie bei Sprungindex-Klauseln) für künftige Jahre vorzubeugen, kann von der im Mietvertrag vereinbarten Anpassungsklausel im Einvernehmen mit dem Mieter auf die Wertsicherungsklausel gemäß dem 5. MILG umgestellt werden (idealerweise mit jährlicher Anpassung ohne Sprungindex). Hierfür ist eine (einmalige) Änderung des Mietvertrages erforderlich (lediglich Abänderung bei der Mietzinsanpassungsklausel).
Zur Abgeltung der Inflationsentwicklung seit der letzten Anpassung bis Ende 2025 ist in diesem Zusammenhang einmalig die Berechnung vorzunehmen (ggf aliquotiert) und mit 01.04.2026 der Mietzins anzupassen. Die künftigen Anpassungen ab dem Jahr 2027 basieren dann ausschließlich auf den Bestimmungen des 5. MILG ohne aufwendige Parallelberechnungen.